

Dieses Interview basiert auf einer Folge des torq.partners Finance Podcasts mit dem Gast Johanna von Herman, Fund Administration Expertin und Business Angel. Die komplette Folge ist auf Spotify und YouTube als Videopodcast verfügbar.
Fund Administration sorgt dafür, dass ein Fonds wie ein Unternehmen funktioniert: Es braucht sauberes Accounting, dokumentierte Geldflüsse und belastbares Reporting. Investor*innen wollen nachvollziehen, wie ihr Kapital eingesetzt wird. Dazu kommen Capital Calls, die professionell gesteuert werden müssen, sowie umfangreiche regulatorische Reportings an BaFin und Bundesbank. Ein zentraler Teil ist außerdem die Steuerseite – von Steuererklärungen für den Fonds bis zu Ergebnismitteilungen für die LPs (Limited Partners).
Alle wissen, dass sie nötig ist, aber niemand will viel Budget dafür ausgeben. Wenn Technologie fehlt, entstehen viele händische Schritte, vor allem in Excel. Zahlreiche Schnittstellen, manuelle Übernahmen und Formate erhöhen die Fehleranfälligkeit – und Fehler landen am Ende im Reporting.
Capital Calls werden oft in Excel berechnet, dann in Word-Dokumente übertragen und serienbriefartig verschickt. Quartalsberichte mit 30 Seiten müssen standardisiert erstellt werden, Daten aus Portfoliounternehmen müssen eingesammelt und Bewertungen sauber durchgeführt werden. Ohne Technologie kann das Wochen dauern.
Viele junge Portfoliounternehmen haben wenig Ressourcen und liefern in unterschiedlichen Formaten. Das erschwert Konsolidierung und Bewertung. Standardisierte Templates helfen, aber Unternehmen mit starker Position drehen den Spieß manchmal um und setzen ihr eigenes Format durch – damit müssen Fonds umgehen können.
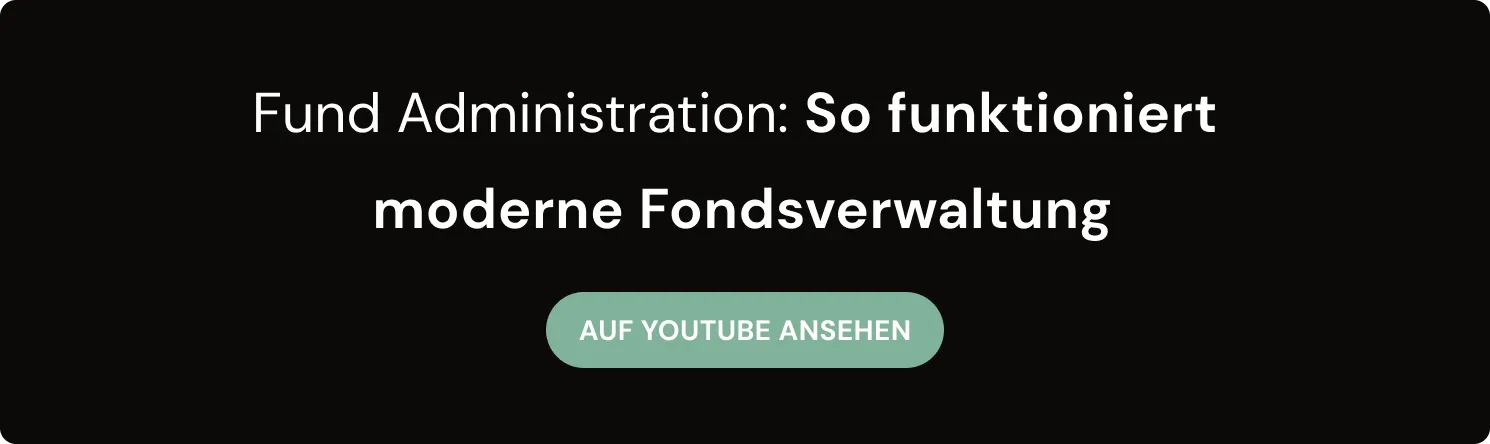
Im Early-Bereich ist die Struktur oft schlank: Management Company, ein bestellter General Partner (GP) und häufig ein Carry Vehicle. Später wird es komplexer – mit mehreren Fondseinheiten unter einer Manco und zusätzlichen Special Purpose Vehicles (SPVs) für spezifische Investments.
Meist gründen ein bis drei GPs und übernehmen anfangs auch das Sourcing. Mit wachsender Größe kommen Investment Manager*innen, Analyst*innen und häufig ein (fractional) CFO dazu. Female GPs sind noch selten – viele trauen sich den Schritt wegen Vereinbarkeitsthemen nicht zu, und die Rolle ist weniger sichtbar. Mehr Aufklärung und Vorbilder sollen das ändern.
LPs erwarten, dass möglichst viel Kapital in Investments fließt und nicht in Overhead. Gleichzeitig vertrauen sie den GPs stark, haben aber keinen Durchgriff auf einzelne Entscheidungen. VC-Fonds sind Closed-End-Vehikel mit typischen Laufzeiten von zehn Jahren plus Verlängerungsoptionen; Kapital wird über Capital Calls abgerufen. Ein Ausstieg ist selten über Secondaries möglich.
Wenn Exits ausbleiben, setzen Fonds zunehmend auf Continuation Funds. Auslaufende Assets werden in einen Anschlussfonds übertragen, der ohne feste Laufzeit weitergeführt wird, bis ein sinnvoller Exit möglich ist.
Der Einstieg passiert oft über Learning on the Job. Gefragt sind u. a. Fund-Accounting-Skills, tiefes Regulatorik-Wissen für Compliance, ESG-Expertise und Steuerberatungskompetenz. Wer viele Fonds sehen und breit arbeiten will, ist bei einem Managed Service/Advisor gut aufgehoben; wer sich auf einen Fonds fokussieren will, wechselt auf die GP-Seite.
Der Weg führte über frühe Kapitalmarktinteressen, später VC-Nähe und den Wunsch nach mehr Nähe zu Start-ups. Thematisch stehen Education/Lifelong Learning und Foodtech/Lebensmittelsicherheit für mich persönlich im Fokus. In sehr frühen Phasen zählen Team, Produktreife, Go-to-Market und die Frage, ob das Team das Business wirklich auf die Straße bringen kann.
Ein unstrukturierter oder fehlender Businessplan ist ein Ausschlusskriterium. Pitch-Decks mit Rechtschreibfehlern fliegen sofort raus. Gründerinnen empfehle ich außerdem, den Schritt zu wagen, Chancen aktiv zu ergreifen und das Risiko anzunehmen – die Datenlage zu geringeren Ausfallraten weiblich geführter Unternehmen verbessert zudem die Fundraising-Perspektive.